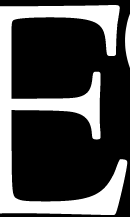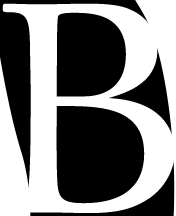Rückblick auf das Jahr 1975
Ein Jahr, vier Jahreszeiten, 365 Tage – keiner wie der andere;
ich lebe und arbeite zum ersten Mal in der Nähe von Winterthur in einem wunderschön romantischen Landatelier
ich bestreite vier Ausstellungen und merke selber deutlich, was die anderen mit „Krise“ meinen.
natürlich ziehe ich als sonnensüchtiger Mitteleuropäer gegen Süden, an und ins Mittelmeer und in guten Stunden weiss ich mich so wunschlos türkisblau und sonnendurchspielt wie das grosse Wasser vor mir –
ich verbringe gute Sonnensommertage im Thurtal und beschliesse in trauriger genauer Betrachtung des unlauteren Flusses, im nächsten Sommer einen Fluss zu suchen, durch dessen Wasser ich auf dem Grund Steine, Fels, Licht- und Schattenspiel der bewegten Oberfläche wahrnehmen kann –
seit dem Spätsommer lebe und arbeite ich oft im Atelier in der Sidi in Winterthur; ich radiere, zeichne mit Rohrfedern, die ich an der Thur geschnitten habe; begegne mir schreibend oder lesend in meinen Tagebüchern; spiele vor dem Atelier Fussball mit kleinen und grossen Kindern; mit Skizzenblock, Farbstiften und Aquarellfarben fahre und streife ich durch unsere Wälder –
Vielleicht so, wie der Herbst zuerst unmerklich Spätherbst wird, stirbt – und erwartet-unerwartet der Winter, ein völlig Neues, sich daherspielt, wächst im Atelier ein Ahornblatt in Herbstfarben, in der nächsten Fassung spielt ein Blatt in den Winter hinüber, Blattspitzen verwandeln sich in eisblaue Berge; umspielt von Herbstlicht und Farbfeuern das Gesicht einer Frau (vielleicht Schneewittchen), fast unmerklich das Gesicht im Bildganzen; in einer Atropa belladonna spiegeln sich Spätherbst und eine schwarze Fee – und für mich selber erwartet-unerwartet, wie ein völlig Neues sich daherspielt, steht jetzt der Mensch im Mittelpunkt meines Suchens:
der Mensch, der mit der Welt spielt
der Mensch, wie er ein Spielball der Welt ist
ich, die eine, ganze und unteilbare Welt (die ich, mehr als mir lieb ist, als in sich selber zerstritten und gespalten erlebe)
ich, winziger Teil dieser einen, ganzen und unteilbaren Welt (sie mir, mehr als mir lieb ist, gespalten und zerstritten entgegentritt)
„Mister World is playing“ nenne ich das Bild, an dem ich jetzt arbeite. (eine Abbildung finden Sie unter Zeichnungen)
Vernissagerede, gehalten im März 1976
Die Werke vor Ihnen und die Bilder, die Sie umgeben, sind schweigend entstanden. Trotzdem führen sie eine Art Sprache: Das Aquarell spricht zuerst in Farben zu Ihnen, die Radierung erzählt in Bildern – schweigend.
Das eine Bild führt vielleicht die Sprache der Augenwirklichkeit, das andere führt eher die Sprache des Traumes; im nächsten Bild verliert sich eine Brücke hinauf ins Nachtblau, wo die Königin der Nacht auf grün-blauem Pferd fliegt....
Sie gehen als Fremder unangesprochen an den Bildern vorüber oder Sie gehen als Mensch, der die Sprache meiner Bilder zu verstehen beginnt, einen Weg, der Sie auf geheimnisvolle Art zugleich ins Dargestellte, Gestaltete vor Ihnen und in Ihre eigenen Bilder führt....
Aus einer Vernissagerede, gehalten im August 1977
Jetzt könnte ich noch Antwort auf die leide Frage geben: „Warum malen Sie eigentlich?“ Das gehört bei witzigen Menschen zum Vernissage-Gesprächs-Katalog. Schaut mir ein Mensch dabei tief in die Augen, frage ich mich mit ihm: Warum male ich? Beim Malen habe ich mir einiges dazu gedacht, obwohl es besser ist, während des Malens nur im Bild zu sein und nicht zu denken. Zuerst: Was tue ich beim Malen? Ich transformiere Linien und Flächen zu einer Illusion, ich ordne Flecken und Schatten und zwei Kreise mit dunklen Kreisen drin zu einem Frauengesicht...
Malen ist eine Möglichkeit, etwas darzustellen, was es gibt, gegeben hat oder geben wird. Schon schwieriger: Etwas darstellen, das es nicht gibt und geben wird.
Malen führt zum Auftreten von Phantasie, wenn ich nicht nur abzeichne.
Malen ist eine Möglichkeit, zu sich zu finden. Es ist aber keine Antwort auf die Frage: Wo bin ich zu finden?
Malen ist eine Art der Selbstverwirklichung. Malen ist ein befreiendes Tun, solange ich nichts Rechtes damit anfangen will.
Malen ist Umgang mit sich selber.
Malen kann sein: Träumen in Farben, fühlen mit Formen, schwelgen im Fliessenlassen von Aquarellfarben.
Malen ist Erzeugen von Illusionen und Scheinwelten. Vielleicht wäre es besser, Gras, Korn und Bäume zu pflanzen.
Malen ist mit Material umgehen.
Malen kann sein: Aufklingen von inneren Welten, die durch mein Tun in mein Bewusstsein treten.
Malen ist Versenkung. Ich bin der Schöpfer meiner Träume, soweit mein Handwerk reicht.
Malen kann sein: Völlig im Einklang mit mir herumabenteuern bis zum Rand der Leinwand.
Ich sitze am Ufer des Flusses, bereit zum Malen. Ohne Gedanken schaue ich, sehe die Farben der Natur, die Lichtspiele: WAS soll ich da mit ein paar Farben in der Hand?
Malen kann sein: Ich beginne trotzdem.
Malen kann sein: Ich lege mich mitten in den farbigen Reichtum, staune, versinke in Farben, tanze im Licht und...
Malen ist irgendwo dort, wo der Fluss der Einbildung in den See des Gestalters mündet. Erst beim Verlassen des Bildes tritt der Maler mit Eulenaugen zurück in unsere geliebte Welt.
Malen ist eine Möglichkeit, jeglicher Arbeit fern zu
bleiben.
Wenn es das Malen nicht gäbe, müsste der Maler es malen, damit man es überhaupt sieht.
Malen ist eine vollkommene Möglichkeit, mit grossem Aufwand, Fleiss, innerem Antrieb, eigener Disziplin und Überwachen der eigenen Disziplin zu einem minimalen Einkommen zu gelangen.
Vor dem Malen könnte sein: Sehen lernen.
Aus einer Rede, gehalten im März 1980
In einer guten Ansprache sollte der Redner eine Plattform oder einen Gedanken-Tummel-Platz finden, der gute Gefühle, Wünsche und angenehme Vorstellungen anspricht. Ich habe einen Inhalt gefunden, am dem Sie sicher Ihre Freude haben: Ferien. Ausser Sie sind eben erst aus den Ferien zurückgekehrt.
Aber meine Rede fängt traurig an: ich habe drei Jahre lang keine Ferien gehabt, von 1997 bis und mit 1999. Winterferien von drei bis sechs Monaten meine ich. Im Sommer ist es ja schön hier, wenn alle in den Ferien weilen.
Die schönsten, kreativsten, wahnsinnigsten und unglaublichsten Winterferien lebte ich 1982 bis 1990 in Zaïre. Ich führte ein gutes Leben dort, konnte inspiriert und aufgestellt arbeiten. Jedes Wochenende habe ich nächtelang zur Musik der besten und der Trottoirbands getanzt. Von meinen Ausstellungen konnte ich gut leben. Nach zwei Epositionen in der Galerie des erfolgreichsten zairischen Bildhauers Maître Lyolo und drei Ausstellungen im Goethe-Institut war ich in Kinshasa bekannt wie ein weisser Tiger und hatte viele zairische Freunde und Sammler und Freunde aus der Schweiz, Deutschland und Belgien. 1991 ging es mit dem Zaire bachab, all meine weissen Freunden mussten flüchten.
Mein Afrika-Heimweh liess mich nicht los und mein Verlangen nach exotischen Winterferien auch nicht. 1992/93 bis und mit 1996 konnte ich wieder wegfliegen für drei bis vier Monate nach Kenya. Schön und gut und gesponsert von der Pro Helvetia, aber nicht vergleichbar mit den sagenhaften Congo-Zeiten. Ausserdem musste ich in den Ferien arbeiten. Das wenigstens in einem wunderschönen Kulturzentrum zwölf Kilometer weit weg vom dreckigen und speedigem Nairobi. Ich gab Kurse, Workshops für ostafrikanische Künstlerinnen und Künstler: zwei Wochen lang, dann mit Zug oder Flugzeug runter nach Mombasa ans Meer und in mein Klima. Nairobi ist kaltes Afrika, gerade recht für die Engländer. Zairische Musiker, die ich dort kennengelernt habe, drückten es so aus: „Patron, tu sais, ça va ici, mais le pain, la bière et les femmes....“
Die Kurse waren ein besonderes Erlebnis und haben mir tiefen Einblick in die ostafrikanische Kultur gegeben. Auch für mich selber wurden es kreative Zeiten. Weil das Projekt 1996 fertig aufgebaut war und dann 1997 auch noch Teile des Kulturzentrums abbrannten, hatte ich drei Jahre lang keine Winterferien mehr. Keine Sponsoren, selber zu wenig Geld – nicht zum Aushalten.
Das Millenium hat einen Wechsel bewirkt, genauer gesagt meine Atelier-Ausstellung 1999. Ich hatte genug Geld und das Ferienziel habe ich selbst ausgewählt: Koh Samui, Thailand. Mein eigenes Ziel war: Am Strand liegen, im Meer schwimmen, die Beine langstrecken, nichts tun, nichts denken, nichts müssen. Herumgehen, herumschauen.
Palmen, Fluss, Meer und Tropenwolken habe ich in Tunesien, Kongo und Kenya viel gezeichnet und gemalt– deshalb bin ich ohne Aquarellfarbe geflogen. Aber weil es einem bei soviel Nichtstun langweilig werden könnte, habe ich vier leere Platten und zwei Stahlstifte mitgenommen und eine Idee hatte ich auch schon im Hinterkopf. Es wurde mir zum Glück nie langweilig, doch aus einem guten Lebensgefühl, aus grosser Leichtigkeit des Seins und aus Gestaltungsfreude habe ich zwei Platten vorgezeichnet, geritzt und dann gegraben.
aus einer Rede, gehalten im Mai 2000, übersetzt aus dem Schweizerdeutschen